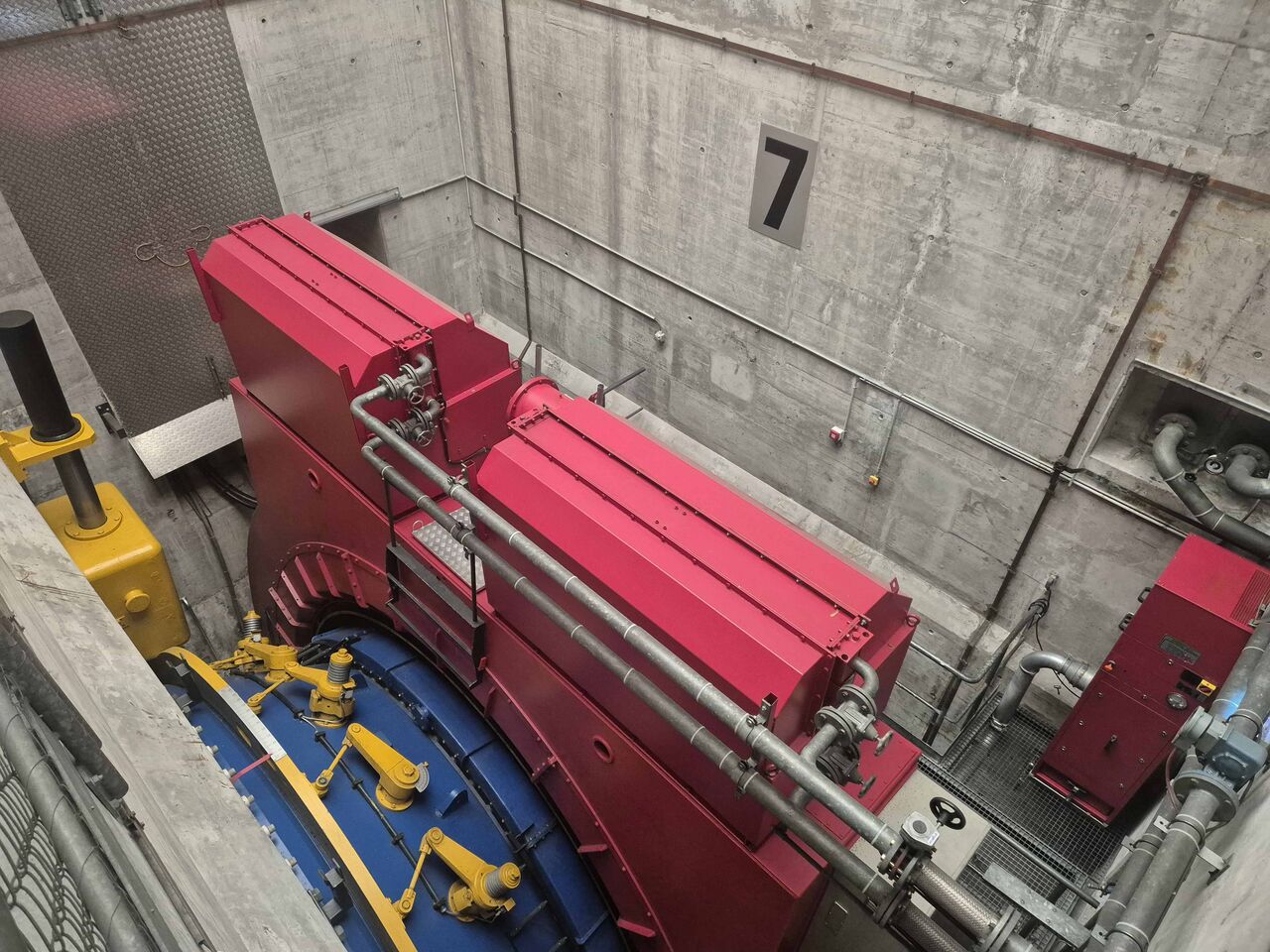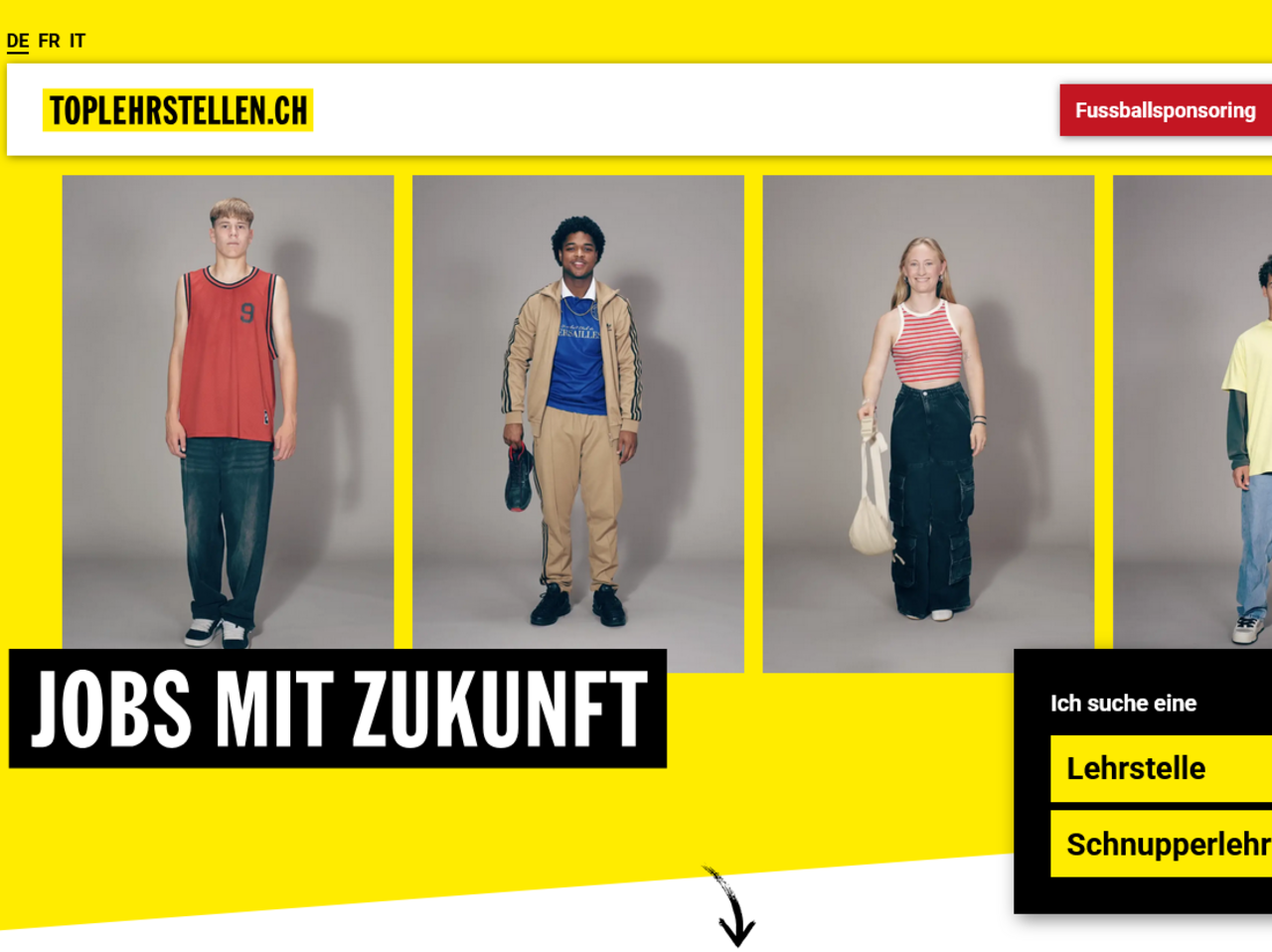Podium mit Marco Waldhauser (Moderator), Beat Flach, Peter Richner, Stephan Sigrist und Oana Bucerzan (Moderatorin, v. l. n. r.). Quelle: Rüdiger R. Sellin
Rüdiger R. Sellin
«Innovation trifft Realität»
Am 17. September 2025 fand der jährliche Gebäudetechnik-Kongress im Trafo Baden statt. Das Motto «Innovation trifft Realität» deutet auf die Herausforderungen hin, welchen sich die Baubranche stellen muss. Insbesondere die zunehmende Bedeutung von KI zeigte sich in vielen Bereichen.
Nach der Begrüssung durch OK-Präsident Matthias Gmür stellten die Moderatoren Oana Bucerzan und Marco Waldhauser die zunehmende Bedeutung Künstlicher Intelligenz (KI) in den Vordergrund, was sich nicht nur in der Verbreitung von Chatbots zeigt. KI beeinflusst zunehmend auch verschiedene Bereiche der Gebäudetechnik.
Umgang mit Innovationen
Gebäudetechniker stehen vor der ständigen Herausforderung, wie man neue Trends einordnen soll. Handelt es sich nur um kurzfristige Hypes oder um nachhaltige Trends? Dieser Frage ging Stephan Sigrist vom «Think Tank W.I.R.E.» in seinem Eröffnungsreferat nach. Aus seiner Sicht prägt das Versprechen von Disruption die Wirtschaft und Gesellschaft seit über einer Dekade. Doch führt eine wiederholte radikale Wende immer zum Ziel? Denn im Umfeld der Gebäudetechnik wurden hohe Erwartungen in Bezug auf grundlegende Innovationen aufgebaut, die sich in der Realität nur teilweise realisiert haben. Mit Blick auf die hohe Dynamik der Veränderung rund um KI sind neue Trends mit einem kritischen Blick auf echten Nutzen jeweils neu zu denken – auch mit Blick auf die effektive Rentabilität neuer Techniken und die Folgen für die Gesellschaft. Dabei sind realistische Zukunftsbilder für die Infrastruktur von morgen aufzubauen, sagte Sigrist.
Theorie und Praxis
Die eidgenössische Material- und Prüfungsanstalt (EMPA) ist ein national anerkanntes Forschungsinstitut. Peter Richner leitete dort während fast eines Vierteljahrhunderts das Departement Ingenieurwissenschaften und stellt sich mit seinem Team den Herausforderungen in Sachen Energie und Klima. Das Potential für eine massive Beschleunigung des ökologischen Umbaus dank innovativer Lösungen ist gross, wird in der Praxis aber oft eingebremst. Als Beispiel nannte Richner das im Juni 2023 vom Parlament beschlossene Klima- und Innovationsgesetz mit dem Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu sein.
Es bleiben also nur noch 25 Jahre zur Umsetzung, was rein technisch möglich wäre – gerade in der Gebäudetechnik. Ein grosses Problem der Schweiz ist das importierte CO2, das über grosse Mengen importierter Waren entsteht. Der promovierte ETH-Chemie-Ingenieur Richner zeigte am Beispiel von CO2-Einschluss in Baubeton und der Gewinnung von Dünger aus gewöhnlichem Urin, wie sich die Ziele mit überschaubarem Aufwand und genügender Rentabilität ganz praktisch erreichen lassen. Trotzdem bestehen Zweifel bezüglich der Erreichbarkeit politisch gesetzter Ziele, weil die Gesetze und Vollzugshilfen zu komplex sind.
Normen und Gesetze als Innovationsverhinderer
In ein ähnliches Horn blies GLP-Nationalrat Beat Flach (Flach Consulting GmbH). Er bemängelte die Vielzahl an Normen, Vollzugshilfen und Empfehlungen, welche das Bauen zunehmend komplex gestalten. Der ausgeuferte Regelwildwuchs führt dabei zu Haftungsängsten und bewirkt, dass Planer und Behörden aus Sorge vor rechtlichen Konsequenzen oft zu übervorsichtigen und zu teuren Lösungen greifen. Nach Meinung von Flach sollte die Baubranche aktiv werden und aufzeigen, was an Regelung zwingend ist und was getrost der Eigenverantwortung überlassen werden kann, was die SIA-Normen durchaus zulassen. Dadurch entsteht Potential für mehr Innovation am Bau statt starrer Vorgaben für jedes mögliche Detail.
Podium: Innovation trifft Realität – Praxis, Potentiale, Probleme
Die Schweiz ist im Bauwesen traditionell gut aufgestellt und pragmatisch unterwegs. Die SIA-Normen geben dabei einen sinnvollen Rahmen für Planer, Bauverwalter und Baufirmen. Das Problem sind weniger die neuen Technologien als der «Mindset», mit dem die Beteiligten unterwegs sind. Immer neue und jeweils komplexere Gesetze erschweren die Erstellung von Neubauten und verhindern eine Verringerung der allgegenwärtigen Wohnungsnot. Hier sind vermehrt Pragmatismus und eine enge Abstimmung unter den Beteiligten gefragt.
Haftungsrisiken bei Innovationsprojekten
Prof. Thomas Siegenthaler (Scherler Siegenthaler Rechtsanwälte AG) knüpfte direkt an das Referat von Beat Flach an und beleuchtete die Haftungsrisiken in Innovationsprojekten im Bau. Basis bildet die SIA-Ordnung 108 sowie das schweizerische Obligationenrecht mit 140 Jahren Rechtsprechung. Die vertragliche Haftung wird zwischen Bauunternehmer, Auftraggeber und -nehmer individuell ausgehandelt. Wichtiger Teil ist dabei die Risikoaufklärung, bei dem alle Parteien die Bauausführung auf ein definiertes Risiko abstimmen. Diese nehmen bisweilen erhöhte Risiken in Kauf, um die Preise zu senken, was die Frage aufwirft, ob und wie allfällige Baumängel versichert sind oder wie anderweitig damit umzugehen ist. Bei Versicherungen gilt der in der Praxis übliche Baustandard zum Zeitpunkt der Bauerstellung. Abweichungen davon sind meist nicht gedeckt, was jegliche Haftung ausschliesst. Dies gilt insbesondere für Neuentwicklungen, die nicht auf bestehenden Standards oder Weiterentwicklungen daraus basieren. Die von Siegenthaler geschilderten Praxisbeispiele zeigen, dass man sich hier oft in Grauzonen bewegt.
Cybersecurity in der Gebäudetechnik
Beim Thema Cybersecurity denkt man eher an Serverfarmen und das globale Internet als an die Gebäudetechnik. Dass dies nicht der Realität entspricht, bewies Martin Gartmann (BKW Building Solutions). Die Bedrohungslage ändert sich dabei tagesaktuell und ist oft von geopolitischen Ereignissen abhängig. In der Gebäudetechnik sind z. B. Sensoren, Kameras oder Türsteuerungen, aber auch vernetzte und computergesteuerte Gebäudetechniksysteme wie Beleuchtung, Klima/Lüftung/Heizung und Sicherheitssysteme anfällig für Angriffe von aussen. Der technologische Wandel ist so gross, dass die IT-Sicherheit eigentlich immer einen Schritt hinter den Angreifern steht. Hier sind schnelle und umfassende Massnahmen und Reaktionen gefordert, besonders wenn Menschenleben bedroht sind, etwa in Spitälern, Bahnhöfen oder Flughafengebäuden.
Simulationstests der BKW Building Solutions zeigen, dass der Zugang zu Gebäudesystemen oft fahrlässig gehandhabt wird. Gartmann berichtete über den Kontrast zwischen Anspruch und Praxis wie fehlende Updates, schwache Passwörter, veraltete Systeme, reale Schwachstellen und aktuelle Bedrohungen. Er wies darauf hin, dass in der Cyberkriminalität mehr Geld verdient wird als im weltweiten Drogenhandel, und rief dazu auf, dem unzureichenden Risikobewusstsein entgegenzuwirken. Ein hohes Sicherheitsniveau ist für vernetzte Systeme der modernen Gebäudetechnik essenziell wichtig, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Innovationen in Unternehmen
Fehlende technologische Reife, unklare Schnittstellen oder starre KPIs sind oft Innovationskiller, so Noemi Rom (Zühlke). Hingegen können technologische Validierungen, iterative Entwicklungen und systemisch gedachte Skalierungsmodelle zur nachhaltigen Umsetzung beitragen. Technologie und Business sind von Anfang an gemeinsam zu denken. Innovationen brauchen jedoch Investitionen, die nur selten hohe Prioritäten geniessen. Dabei sind neue Messgrössen für Innovation nötig, z. B. Schnelligkeit, eine agile Denkweise und eine offene Kultur mit dem Mut zu Fehlern, sagte Rom. Eine Art «Risikoappetit» und eine Innovationskultur sind hier zentral. Klassische Unternehmensabläufe, eine eingefahrene Unternehmenskultur oder veraltete Messgrössen verhindern hingegen Innovationen.
Vom Bauprojekt zum Produkt
Daniel Scherrer von «Glück Blueprint» will mit neuen Tools das Planen, Bauen und Wohnen revolutionieren. Ineffiziente Einzelprojekte werden dank plattformgesteuerter Planung zu einem skalierbaren Produkt transformiert. Durch systematische Parametrisierung und standardisiertes Design wird ein Grossteil der Entwicklungs- und Ausführungsplanung skalierbar. Lediglich orts- und gemeindespezifische Anpassungen bleiben erhalten. Ein erster Prototyp in Zürich zeigt, wie die optimale Balance zwischen Effizienz und architektonischer Qualität erreicht werden kann. Ein Erfolgsfaktor war die Reduktion der Anzahl von Schnittstellen, was die Planungszeit reduzierte und zugleich die Planungssicherheit erhöhte.
Bohren neu gedacht: Hilti Jaibot
Hilti machte 2024 CHF 6,4 Mia. Umsatz und investierte CHF 466 Mio. in Forschung und Entwicklung. Dank Direktvertrieb sind die Wege vom Kunden zum Unternehmen und auch innerhalb der Firma kurz. So kam der Anstoss zu einem Bohrroboter vom Chef persönlich, verriet Andreas Meier dem Publikum. Der nun trotz diverser Herausforderungen verfügbare Hilti Jaibot ist ein halbautomatischer Bohrroboter, der sich für Decken- und Wandbohrungen, heute aber nur für gerade Flächen eignet. Er verbindet dabei Effizienz mit Präzision, weshalb sich Bauprojekte schneller, sicherer und produktiver umsetzen lassen. Durch die digitale Vernetzung mit BIM-Daten bohrt er automatisch nach Plan, reduziert Fehler und entlastet das Fachpersonal. Dadurch entsteht eine kleinere körperliche Belastung und eine höhere Genauigkeit mit schnellerer Fertigstellung von Projekten.
Mit KI vergessene Fehler aufspüren
Komplexe Projekte, wachsende Normenvielfalt und Ressourcenknappheit fordern das Qualitäts- und Risikomanagement im Bauwesen heraus. Dabei schreitet die technische Entwicklung immer schneller voran. So verdoppelt sich die verfügbare Rechenleistung längst schneller, als im Moore’schen Gesetz festgelegt. In wenigen Jahren wird dieses Verdoppelungsintervall nur noch 18 Monate betragen. Was bedeutet dies für die Baubranche? Hier werden Risiken dank KI-Tools wie Nukleus frühzeitig sichtbar und stärken die Qualitätssicherung. Ein digitaler Assistent sammelt dabei projektbezogene Daten und wertet sie KI-gestützt aus. Fehlerquellen werden damit aufgespürt und beseitigt, was die Projektführung proaktiver, transparenter und effizienter werden lässt. Dawidowicz benennt eine Kosteneinsparung von 10 %.
Die digitale Schaltplantasche
Wer kennt sie nicht: Elektroschaltpläne in Papierform. Oft sind sie unvollständig, veraltet oder unleserlich. Die Zukunft der Anlagendokumentation könnte aus einem simplen QR-Code im Schaltschrank bestehen, welcher das Papier ersetzt. René Huber stellte dazu die cirQit-App vor, mit der Pläne digital per Smartphone oder Tablet abgerufen und vor Ort bearbeitet werden können. Alle Änderungen sind dabei dokumentiert und werden dem Ersteller gemeldet, der sie im CAD-System übernimmt und das aktualisierte PDF in der Cloud speichert. Auf diese Art und Weise ist die lokale Dokumentation dank Digitalisierung stets aktuell und standortunabhängig griffbereit. Dieses Vorgehen vereinfacht die Fehlersuche oder Anlageninspektion. Als nächsten Schritt ist eine KI-unterstützte Fehlersuche angedacht.
Digitale Transformation in der Orthopädie
Das Schweizer Gesundheitssystem steht unter grossem Effizienzdruck und hat zahlreiche Digitalisierungsschritte bereits vollzogen. Ob in der Administration, auf den Stationen oder im Operationssaal – die digitale Transformation der Medizin schreitet voran. Dabei sind innovative Ansätze im Spannungsfeld zwischen technologischen Möglichkeiten und regulatorischen Anforderungen gefordert. Die Universitätsklinik Balgrist/Zürich hat dabei vor allem Patienten mit Einschränkungen des Bewegungsapparates im Fokus.
Gemäss Sebastiano Caprara, promovierter ETH-Maschinenbauingenieur, strebt die Klinik eine Integration datengetriebener Werkzeuge wie KI in betriebliche Abläufe an, welche klinische Entscheidungen und administrative Arbeiten unterstützen sollen. Dabei kommen «Digital Twins» und 3D-Modelle zum Einsatz – eine virtuelle Kopie des Patienten, welche den gesamten Behandlungsprozess des Patienten von der Diagnose über die OP bis hin zur Rehabilitation begleitet. Dies erfolgt stets unter Berücksichtigung von Datenschutzbestimmungen und der Patientensicherheit. Durch enge Zusammenarbeit mit der akademischen Forschung werden Synergien geschaffen, um Innovationen nachhaltig und praxisnah umzusetzen.
Innovation moderner Flugzeugtechnologien
Das Umfeld der Flugzeugtechnologien ist hochreguliert und hochkompetitiv. Das spürt auch die Traditionsfirma Pilatus, wie Urs Thomann ausführte. Er beschrieb den Innovationsprozess eines Luftfahrzeugentwicklers und -herstellers mit konkreten Beispielen aus der Technologie- und Produktentwicklung. Die Luftsicherheitsbehörde (hier die EASA) definiert dabei die Zertifizierungsbedingungen und Sicherheitsanforderungen. Neu entwickelte Flugzeuge mit neuen Konstruktionsbedingungen müssen dabei genauso sicher sein wie konventionell konstruierte Maschinen.
Ein Flugzeug muss trotz aller Auflagen immer möglichst leicht sein mit dem Ziel, teuren Kraftstoff einzusparen und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Pilatus ist dabei auf Zulieferer angewiesen, die ebenfalls Teil der Zertifizierung sind. So wiegt ein PC-24 flugbereit nur 8,5 t. Zudem müssen viele Pilatus-Jets auch auf schlechten Pisten und bei schlechtem Wetter landen können. Am Beispiel eines 3D-gedruckten (statt bisher gefrästen) Titanteils zeigte Thomann auf, wie interne Zielsetzungen und externe Anforderungen – etwa aus Markt, Regulierung und Nachhaltigkeit – den Entwicklungsprozess prägen und welche Herausforderungen daraus erwachsen.
Die Zukunft des vernetzten Mehrfamilienhauses
Das Thema Smarthome ist oft Gegenstand von Kongressen, Fachartikeln und Vorträgen. Das daraus resultierende Smart Living ist der nächste Schritt und soll das Wohnen im vernetzten Mehrfamilienhaus revolutionieren. Intelligente Technologien und digitale Lösungen sollen dabei Effizienz, Nachhaltigkeit und Komfort steigern. Diesem Thema hat sich auch Schneider Electric verschrieben, sagte Kreshnik Peci. Damit das Ganze nicht auf halber Strecke stecken bleibt, sind entsprechende Rahmenbedingungen wie technische Standards, eine flexible und einfache Planung sowie eine robuste Cybersecurity erforderlich.
Letztere gewährleistet einen umfassenden Datenschutz. Modulare Architekturen ermöglichen begleitend die Integration von Energiemanagementlösungen sowie Dienst- und Serviceleistungen externer Partner. Damit entsteht ein flexibles Ökosystem für «Smart Living» mit kontinuierlichen Innovationen zur Reise in eine digitale Zukunft. Problematisch sind fragmentierte Standards, was die fehlende Interoperabilität erklärt. Schneider stellt sie über offene Schnittstellen wie APIs her und bezieht Systeme wie KNX, Matter oder BACnet ein.
Weniger Streit und mehr Harmonie dank SIA 2065
Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) publizierte im Sommer 2024 das neue Merkblatt 2065 «Planen und Bauen in Projektallianzen». Es schlägt ein neues Abwicklungsmodell vor, das eine partnerschaftliche Zusammenarbeit fördern will. Mario Marti (Kellerhals Carrard) beleuchtete dessen Entstehung, das auf eine Doktorarbeit von Patrick Schurtenberger am Institut für Baurecht der Uni Fribourg zurückgeht. Darin wurde ein hilfreicher Allianzvertrag definiert, der ein Vertragsmodell zur Überwindung von Spannungen in Bauprojekten zum Ziel hat. Im Zentrum steht die Stärkung des Kooperationsgedankens zwischen Bauherrschaft und den übrigen Beteiligten. Ob dabei tatsächlich weniger Streit oder sogar mehr Harmonie entsteht, muss jeweils die praktische Umsetzung zeigen.
Eine Art Leuchtturmprojekt liefert dazu der Campus Sursee, wo ein bestehendes Schulhaus nach dem SIA-Merkblatt 2065 «Planen und Bauen in Allianz» erfolgreich umgebaut und erweitert wurde. Die praktizierte partnerschaftliche Zusammenarbeit stellte an alle Projektbeteiligten hohe Anforderungen, u. a. in den Bereichen Kommunikation, Vertrauen und gemeinsame Zielverfolgung. Trotz diverser Herausforderungen während der Umsetzung wurde das Projekt plangemäss und erfolgreich abgeschlossen.
Nur Heizungen tauschen reicht nicht!!!
Die Baubranche verfügt längst über die nötige Technik zum ökologischen Heizen. Doch nach Meinung von Patrick Stähler (fluidminds) fehlen die Geschäftsmodelle für ein fossilfreies, komfortables und bezahlbares Energiesystem. Gefragt sind somit innovative Ansätze, welche Wärme, Mobilität und Strom intelligent vernetzen und dabei Komfort, Netzstabilität mit echtem Kundennutzen verbinden. «Heartbeat AI» von 1KOMMA5 bietet mit einem KI-basierten Energiemanagementsystem einen Lösungsansatz. Es vernetzt PV-Anlagen, Stromspeicher, Wärmepumpen und Ladesäulen und steuert das Gesamtsystem mit dem Ziel, die Stromkosten durch die Nutzung günstiger Börsenpreise und die Optimierung von Eigenverbrauch und Einspeisung zu senken.
Fazit
Der Kongress zeigte mit abwechslungsreichen Themen auf, wie die Digitalisierung trotz bestehender Herausforderungen einen echten Mehrwert für die Bauwirtschaft bietet. Praxisbeispiele und Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Projekten und Initiativen verdeutlichten, wie moderne, KI-gesteuerte Tools zu weniger Komplexität und mehr Effizienz führen – dies bei konsequenter Anwendung, offenem Datenaustausch und hoher Security.